Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
September 19, 2025
Ich habe eine echte Schwäche für Heist- und Kunstraubfilme. Die Nonchalance von Pierce Brosnan als Thomas Crown, das Teamwork in den Ocean-Filmen oder der Witz und die Chemie von Audrey Hepburn und Peter O’Toole in How to Steal a Million: Kunstraub – das klingt nach Tresoren, getarnten Fluchtwagen und perfekt getimten Plänen. Dem kann ich mich nicht entziehen.
In der Realität wirken Kunstdiebstähle oft weit weniger glamourös und manchmal erstaunlich unspektakulär. Doch es gibt Raubzüge in der Kunstgeschichte, die so unwahrscheinlich klingen, dass sie genauso gut einem Drehbuch entsprungen sein könnten. Davon möchte ich heute drei vorstellen.
Übrigens: Wenn es um gestohlene Kunst geht, gibt es einen Namen, der immer wieder auftaucht – Vincent van Gogh. Kaum ein anderer wurde so oft gestohlen. Seine Bilder verschwanden aus Museen, tauchten in Mafia-Verstecken wieder auf oder wurden kurzerhand in Autos zurückgelassen. Dass Van Gogh weltweit zum Lieblingsopfer von Kunstdieben geworden ist, hat mehrere Gründe.
Vincent van Gogh war unglaublich produktiv. Obwohl er nur 37 Jahre alt wurde und erst mit 27 Jahren zu malen begann, hinterließ er knapp 900 Gemälde und über 1000 Zeichnungen. Kein Wunder also, dass er schon prozentual einer der meist geklauten Künstler sein muss. Seine Werke gehören aber auch zu den wertvollsten der Welt, und jeder erkennt sofort den Namen. Das macht seine Bilder für Diebe attraktiv, auch wenn sie praktisch unverkäuflich sind.
Vielleicht hat es aber auch etwas damit zu tun, dass van Gogh seine Verletzlichkeit in seine Bilder legte und dass Kunsträuber das unbewusst erkennen und sie deshalb oft wählen. Wer weiß?
Jedenfalls gibt es immer wieder Einbrüche in kleinere und größere Museen, um an Van Goghs Meisterwerke zu gelangen.
Zuletzt im März 2020, während der Corona-Lockdowns, als Van Goghs Frühlingsgarten (auch bekannt als Pfarrgarten in Nuenen im Frühling) aus dem Singer Laren Museum in den Niederlanden gestohlen wurde. Das Bild wurde 2023 in Amsterdam bei einem ehemaligen Kunstdieb wiedergefunden und zurückgegeben. Diese Geschichte erzähle ich heute nicht, aber in einer meiner drei Raubgeschichten spielt Van Gogh ebenfalls eine Rolle.
Es ist der Morgen des 27. April 2003. Die Mitarbeiter*innen der Whitworth Art Gallery beginnen mit ihrem Rundgang durch die Räume, um das Museum für den Tag vorzubereiten. Der Margaret Pilkington Room ist Teil der Hauptausstellung. Hier zeigt die Galerie Arbeiten auf Papier aus ihrer Sammlung und hier stoßen die Mitarbeiter auf drei leere Rahmen an der Wand.
Sofort wird die Polizei gerufen. Alles spricht dafür, dass die Diebe die drei Werke gezielt auswählten. Es handelt sich um The Fortification of Paris with Houses von Vincent van Gogh, Poverty von Pablo Picasso und Tahitian Landscape von Paul Gauguin. Die Whitworth Art Gallery ist spezialisiert auf Papierarbeiten und besitzt eine große Sammlung von Grafiken, Zeichnungen und Aquarellen (u. a. Turner, Blake, Hockney). Aber Van Gogh, Picasso und Gauguin sind natürlich die größten „Zugpferde“ im internationalen Ranking.
Zwar handelt es sich weder um die größten Meisterwerke der Künstler noch sind es die teuersten Werke des Hauses, aber sie gehören zweifellos zu den bekanntesten und publikumswirksamsten Ausstellungsstücken. Es ist also kaum verwunderlich, dass der Raub in der Stadt große Wellen schlägt. Noch bevor weitere Details bekannt werden, melden die ersten Medien bereits einen „schweren Kunstraub“ und die „Katastrophe für Manchester“.
Die britische Presse spricht von einem „verheerenden Verlust“ und einem „unwiederbringlichen Schlag“ für die Whitworth Art Gallery. Manche Schlagzeilen suggerieren, die Bilder seien wahrscheinlich schon aus dem Land geschmuggelt oder für immer verschwunden.
Doch nur weniger Stunden später erhält die Polizei einen anonymen Hinweis. Daraufhin durchsucht sie eine öffentliche Toilette, die nicht in Betrieb ist, im Whitworth Park, gleich neben dem Museum. Und tatsächlich, sie finden eine Papprolle, in der sich alle drei Werke befinden – und außerdem ein Zettel mit der Nachricht:
The intention was not to steal but to highlight the woeful security.
(Wir wollten nicht die Bilder stehlen, nur auf die schrecklichen Sicherheitsvorkehrungen des Museums hinweisen.)
Die Erleichterung ist groß. Doch da es sich bei allen drei Werken um Aquarelle auf Papier handelt, führte die Aufbewahrung in der Papprolle und die feuchte Umgebung zu leichten Beschädigungen wie Wasserrändern, gewelltem Papier oder kleinen Rissen.
Die Werke werden in die Restaurierungswerkstätten der Whitworth Art Gallery gebracht. Nach einigen Monaten können sie wieder ausgestellt werden.
Die Kombination aus Schock und Kuriosität hat den Raub über Manchester hinaus in die internationalen Schlagzeilen gebracht. Zeitungen in Europa und den USA berichteten nicht nur über den Diebstahl, sondern auch über die ungewöhnliche „Rückgabe“ und die Blamage für das Sicherheitssystem des Museums. Dieses wurde dann natürlich auch nachgebessert, wenn auch darüber verständlicherweise nichts Näheres bekannt ist.
Harpers Ferry in West Virginia ist ein kleiner Ort an der Mündung des Shenandoah in den Potomac. Der Ort ist historisch bekannt wegen des Sklaverei-Aufstands von John Brown (1859) und spielte auch im Bürgerkrieg eine Rolle. Die Stadt und die umliegende Landschaft bilden zusammen den Harpers Ferry National Historical Park.
Der historisch geprägte Ort mit seinen Antiquitätenläden ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Die kleinen Märkte, die regelmäßig stattfinden, sind bei Sammlern beliebt, weil man dort immer mal wieder hübsche Stücke finden kann.
2009 besucht eine Frau aus dem benachbarten Bundesstaat Virginia den Flohmarkt von Harpers Ferry. Sie schlendert über den Markt. Hier und da fällt ihr Auge auf ein Stück. Unter anderem interessiert sie sich für einen Bilderrahmen. Er ist nichts Besonderes, aber hübsch und dekorativ. Am Ende des Tages bringt sie eine kleine Kiste mit ihren Errungenschaften nach Hause. Darunter befindet sich auch der Rahmen (inklusive Bild). Insgesamt hat sie an diesem Tag 7 $ auf dem Flohmarkt ausgegeben.
Drei Jahre lang behält sie das Bild. Vielleicht hängt es an ihrer Wand, vielleicht verstaubt es auch in einem Regal. 2012 jedenfalls kommt sie auf die Idee, es zu verkaufen. Ein altes Ölbild in einem dekorativen Rahmen, sowas bringt bei einer Auktion auch als nettes Dekostück oder antikes Bild eines unbekannten Malers ein bisschen Geld, bestimmt jedenfalls mehr als 7 $.
In den USA nehmen viele regionale Auktionshäuser auch Alltagsgegenstände, Schmuck oder Möbel entgegen, nicht nur Spitzenkunst und so gelangt das Gemälde schließlich zur Potomac Company in Alexandria. Dort soll es versteigert werden. Im Zuge der Vorbereitungen katalogisieren und prüfen die Expert*innen das Werk. Und dabei kommt es zu einer großen Überraschung. Das unscheinbare Bild in dem unscheinbaren Rahmen ist ein echter Renoir! Schätzwert: 75.000–100.000 US-Dollar.
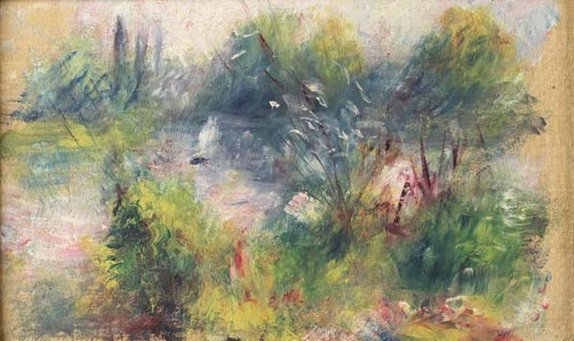
Auguste Renoir, Paysage Bords de Seine, Baltimore Museum of Art
Allerdings wird es nicht für diese Summe verkauft. Denn wie sich herausstellt, war es 1951 aus dem Baltimore Museum of Art gestohlen worden. Das Gemälde Paysage Bords de Seine war 1937 von der Sammlerin Saidie May dem Museum vermacht worden. Sie war eine ihrer wichtigen Mäzene.
1951 verschwand das kleine Renoir-Gemälde aus einer Ausstellung. Ob es über Nacht oder während der Öffnungszeiten verschwand, ist nicht eindeutig dokumentiert. Das Bild ist sehr klein (14 × 23 cm, Öl auf Leinwand), man hätte es relativ leicht abnehmen und unter einem Mantel oder in einer Tasche verschwinden lassen können. Aber ob es so gewesen ist …?
Der Fall wurde der Polizei gemeldet, aber nie aufgeklärt. Das Bild galt seitdem als verschollen. Wie es vom Museum auf den Flohmarkt gelangte, ist bis heute ungeklärt. Weder Täter noch Weg des Bildes konnten jemals rekonstruiert werden.
Da das Gemälde nachweislich gestohlen war, gehörte es rechtlich weiterhin dem Baltimore Museum of Art. Die Flohmarktbesucherin konnte es also nicht behalten. Auch wenn sie das Gemälde in gutem Glauben gekauft hatte, erhielt sie weder einen Finderlohn noch eine Entschädigung. Nicht einmal ihre 7 $ bekam sie erstattet.
Das Gemälde ist nach der Rückgabe 2014 wieder ins Baltimore Museum of Art eingegangen. Dort ist es Teil der Saidie May Collection, zu der es auch ursprünglich gehörte.
1934 erschüttert ein Raub in der St.-Bavo-Kathedrale in Gent nicht nur Belgien, sondern ganz Europa. Zwei Tafeln des berühmten Genter Altars von Jan van Eyck werden gestohlen. Das Werk gilt als Wendepunkt, als ein monumentales Meisterstück, das die nördliche Renaissance einleitete.
In der Nacht auf den 11. April sehen Zeugen die schemenhaften Schatten zweier Personen, die flache Gegenstände in ihren Wagen legen. Am nächsten Morgen stellt der Küster Van Volsem bei seiner morgendlichen Runde fest, dass die Tür zur Vijd-Kapelle, in der sich der Altar befindet, aufgebrochen ist. Seine sofort aufflammenden Befürchtungen sind wahr.
Die beiden Tafeln Johannes der Täufer und Die gerechten Richter sind verschwunden. Stattdessen befindet sich auf dem Rahmen ein Zettel (in französischer Sprache) mit der Botschaft „Von Deutschland mittels des Versailler Vertrags abgenommen.“
Im Ersten Weltkrieg war der Altar von den Deutschen beschlagnahmt und nach Deutschland gebracht worden. Der Versailler Vertrag von 1919 verfügte, dass Deutschland den Altar nach Belgien zurückgeben musste. Gibt es also einen politischen Zusammenhang?
19 Tage lang geschieht nichts. Zwar ist das Land in großer Aufregung, aber die Polizei findet trotz ausgiebiger Untersuchungen weder Fingerabdrücke noch sonstige Spuren. Doch Ende April erhält der Bischof von Gent, Honoré Coppieters, einen Brief. Darin fordern der/die Diebe eine Million belgische Franc Lösegeld und drohen anderenfalls mit der Zerstörung der Tafeln. Unterschrieben ist der Brief mit D.U.A.
Bischof Coppieters ist bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Für ihn steht der Erhalt des Altars als Heiligtum der Kathedrale im Vordergrund. Die belgische Regierung ist jedoch strikt dagegen. Sie will weder Kriminellen Geld geben noch Nachahmer ermutigen.
Der Erpresserbrief enthält auch Anweisung für eine chiffrierte Kommunikation über die Brüsseler Zeitung „La Dernière Heure“. Auf diesem Weg verhandelt der Bischof weiter mit den Erpressern und erbittet Garantien.
Spürst du schon den Vibe von Hollywood in dieser Geschichte? Und dabei ist das noch lang nicht alles - und jedes Wort wahr!
Also, nach einigem Hin und Her und mehreren Briefen seitens des/der Diebe und Zeitungsanzeigen seitens des Bischofs sind der/die Diebe tatsächlich bereit ihren guten Willen zu zeigen. Mit dem nächsten Brief senden sie auch den einen Abholschein für die Gepäckaufbewahrung am Bahnhof Brüssel-Nord. Und dort befindet sich, aufgegeben von einem Mann mit Spitzbart, die Tafel mit Johannes dem Täufer.
![Christus[23] mit Maria und Johannes dem Täufer Kopie Der Genter Altar, ein berühmter Kunstraub](https://leafinke.de/wp-content/uploads/2025/09/Christus23-mit-Maria-und-Johannes-dem-Taeufer-Kopie.png)
Genter Altar: Maria, Gottvater und Johannes der Täufer (rechts).
Einige Tage später kommt ein weiterer Brief mit Anweisungen und einer zerrissenen Zeitungsseite. Das Lösegeld soll im Pfarrhaus von Meulpas hinterlegt werden, ein Bote wird kommen, um es zu holen und die zweite Hälfte der Zeitungsseite wird sein Erkennungszeichen sein – echter Filmstoff, oder?
Jedenfalls, genau so passiert es auch. Ein Taxifahrer kommt, er hat den Zeitungsfetzen und er nimmt das Paket mit dem Lösegeld mit. Man könnte also meinen, Ende gut, alles gut. Nur dachte die Polizei, die zurückgegebene Tafel sei ein Zeichen der Schwäche. Deshalb legte sie statt einer Million nur 25.000 Franc in das Paket.
Erwartbarer Weise trifft das bei dem/den Tätern nicht auf Begeisterung. Wieder gehen Nachrichten hin und her, bleiben letztendlich aber erfolglos. Am 1. Oktober 1934 triff der letzte Brief beim Bischof von Gent ein. Die Tafel der gerechten Richtern bleibt verschwunden.
Szenenwechsel. Sechs Wochen später. Der flämische Geschäftsmann, Laienprediger und ehemalige Bankangestellter Arsène Goedertier hält bei einem politischen Parteitreffen in Dendermonde eine Rede. Kurz darauf bricht er mit einem Herzinfarkt zusammen. Schnell wird er in das nahe gelegene Haus seiner Schwagers gebracht. Während man nach dem Arzt schickt, sagt Goedertier: „Ich allein weiß, wo sich das Altarstück befindet. Niemand sonst weiß es.“
Sein Zustand verschlechtert sich. Sein Freund, Notar Georges de Vos, ist bei ihm. Ihm flüstert er seine letzten Worte ins Ohr. „In meinem Schreibtisch … Schlüssel … Schrank … Ordner der Krankenkasse …“ Dann stirbt er.
Nach seinem Tod wird sein Büro durchsucht und man findet auch den Ordner. Darin befinden sich Abschriften der insgesamt 13 Erpresserbriefe, die dem Bischof von Gent geschickt wurden. Aber von der Tafel Die gerechten Richter fehlt jede Spur.
Diese Geschichte enthält mehr als genug, um diesen Raub zur Legende zu machen. Generationen von Schatzjägern suchen seitdem in Wetteren, in Kirchen, Gräbern, Kellern, Parks oder sogar Kanälen nach der verlorenen Tafel. Bis heute wurde sie nicht gefunden, auch wenn immer mal wieder Gerüchte über eine heiße Spur auftauchen.
1945 schuf der Maler Jef Van der Veken eine Kopie, die bis heute im Altar zu sehen ist.
Aber selbst damit ist die Geschichte des Altars nicht beendet. Als sich 1939 der Zweite Weltkrieg abzeichnet, wird der Genter Altar zunächst zerlegt und an verschiedenen Orten in Belgien in Sicherheit gebracht, um ihn vor Zerstörung oder Diebstahl zu schützen. Nach der deutschen Invasion fällt der Altar in die Hände der Nazis. Er steht auf Hitlers „Sonderliste“ für das geplante Führermuseum in Linz.
Die Nazis beschlagnahmen den Altar und bringen ihn nach Neuschwanstein, später nach Österreich. Ab 1943 verändert sich die Lage im Krieg dramatisch. Die Alliierten bombardieren zunehmend deutsche Städte und Industrieanlagen. Damit steigt die Gefahr, dass auch eingelagertes Raubgut zerstört werden könnte.
Die Nazis beginnen, die wertvollsten Stücke in Salzbergwerken einzulagern. Neben dem Genter Altar wurden auch die Brügger Madonna von Michelangelo sowie Gemälde von Vermeer, Rembrandt und Rubens in Altaussee eingelagert.
Im Mai 1945 entdeckten die alliierten Kunstschutz-Offiziere („Monuments Men“) die Bestände in Altaussee, mehr als 4700 Kunstwerke!
Kunstraub hat also tatsächlich manchmal etwas von einem Heist-Film. Manchmal sogar chaotischer, absurder und rätselhafter als in Hollywood.
Jetzt für den Newsletter anmelden und
nichts mehr verpassen
Erhalte exklusive Einblicke in meine kreativen Prozesse, erfahre die Geschichten hinter meinen Kunstwerken
und erhalte Einladungen zu meinen Ausstellungen und Events.
Als Dankeschön schenke ich dir 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
[…] Kunstraub – und was dann geschah […]